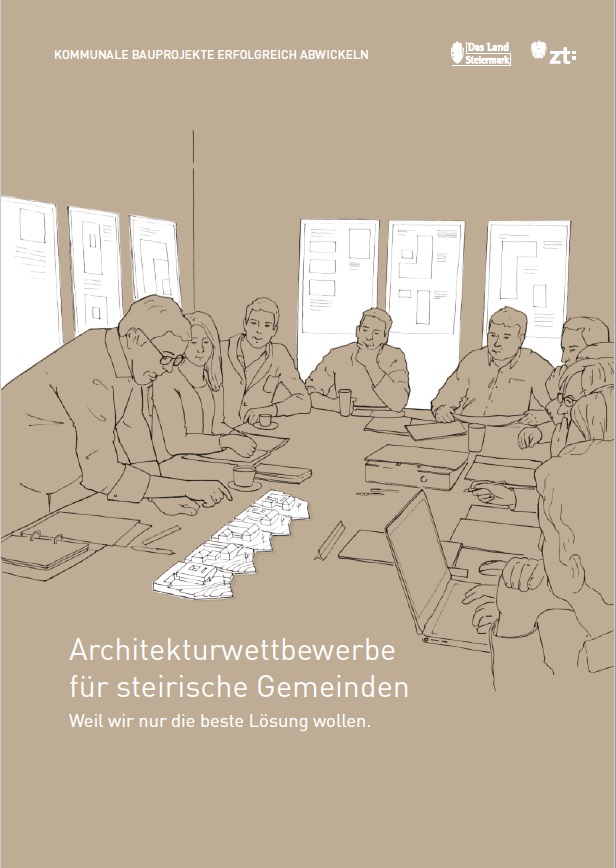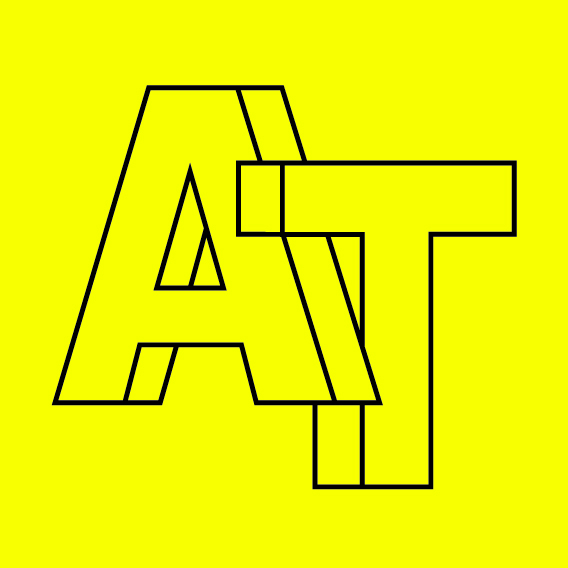Haftung der ZiviltechnikerInnen für Verfassung von VertragsbedingungenZiviltechnikerInnen sind bei ihrer Auftragsabwicklung oftmals mit der Beratung des Auftraggebers/der Auftraggeberin bei der Abfassung von Vertragsbedingungen befasst. Grundsätzlich beziehen sie sich hiebei auf standardisierte Texte, insbesondere die ÖNORM B 2110. Auch wenn es sich bei dieser Norm um einen „ausgewogenen Kompromiss zwischen den Interessen der an Werkverträgen beteiligten Personen“ handelt, könnte die anstandslose Zugrundelegung dieser Norm den/die ZiviltechnikerIn mit Haftungsfolgen konfrontieren. Vorausschickend soll festgehalten werden, dass bezüglich der Frage, ob ZiviltechnikerInnen befugt sind, Vertragsbedingungen zu formulieren, einhellig die Auffassung vertreten wird, dass dies im Zuge von Auftragsabwicklungen im Rahmen seines/ihres Fachgebietes bejaht wird. Dabei wird er/sie sich anerkannter Texte zu bedienen haben. Die Berechtigung des/der ZiviltechnikerIn ergibt sich aus dem für die Befugnis maßgeblichen Studienplan, der in der Regel eine Ausbildung im Bauvertragsrecht bzw. Verdingungswesen beinhaltet. Ein Recht zur umfassenden, gesonderten Rechtsberatung wird von der Befugnis mangels ausreichender juristischer Ausbildung meist nicht enthalten sein (Zitat: Seebacher, Die Haftung des Architekten für die Erstellung von Vertragsbedingungen in der Ausschreibung, in "bau aktuell", Juli 2010). Bei der Verwendung von standardisierten Vertragstexten, wie der ÖNORM B 2110, ist zu beachten, dass diese in einigen Punkten zum Nachteil des Auftraggebers/der Auftraggeberin von den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen abweicht. Sollte der/die ZiviltechnikerIn den/die AuftraggeberIn darauf nicht explizit hingewiesen haben, könnte im Fall eines daraus resultierenden Schadens ein Verschulden des Ziviltechnikers/der Ziviltechnikerin aufgrund einer Verletzung seiner/ihrer Warn- und Aufklärungspflicht gesehen werden. Zu dieser Thematik gibt es in Deutschland bereits oberstgerichtliche Entscheidungen, welche besagen, dass der/die AuftragnehmerIn den/die AuftraggeberIn über die Unterschiede zwischen den Inhalten vornormierter Vertragsmuster und der geltenden Gesetzeslage zu beraten und auf „Schwachstellen“ hinzuweisen hat. Erfolgt diese Aufklärung nicht, haftet der/die AuftragnehmerIn für den dadurch verursachten Schaden. Eine entsprechende Judikatur fehlt bei uns noch. Auf jeden Fall sollten ZiviltechnikerInnen daher ihre AuftraggeberInnen im Fall der Verfassung von Auslobungsunterlagen auf folgende Abweichungen der ÖNORM B 2110 zur geltenden Gesetzeslage hinweisen, um keine Haftungstatbestände zu verwirklichen. Seitens des Auftraggebers/der Auftraggeberin ist zu entscheiden, ob die Formulierung der ÖNORM B 2110 dennoch übernommen werden soll. Gegebenenfalls ist die Beratung durch einen Rechtsanwalt/eine Rechtsanwältin zu empfehlen. Unterschied private/r – öffentliche/r AuftraggeberIn Der/Die AuftraggeberIn kann in den Ausschreibungsunterlagen in einzelnen Punkten von dieser ÖNORM abweichen, die Gründe für die abweichenden Festlegungen sind vom Auftraggeber/von der Auftraggeberin aber festzuhalten und den UnternehmerInnen auf Anfrage unverzüglich bekannt zu geben. Abweichungen ÖNORM – ABGB
Gemäß § 918 ABGB kann der/die AuftraggeberIn bei Verträgen, die von einem Teil entweder nicht zur gehörigen Zeit, am gehörigen Ort oder auf die bedungene Weise erfüllt werden, Erfüllung und Schadenersatz wegen Verspätung begehren oder unter Festsetzung einer angemessenen Frist zur Nachholung den Rücktritt vom Vertrag erklären. Die ÖNORM B 2110 sieht dazu folgende Regelung vor: Punkt 5.8.1: Die Berechtigung zur Aussprache des Rücktritts ist kurz gehalten. Sie beträgt 30 Tage ab Kenntnis des Rücktrittsgrundes. Eine abweichende Regelung wird bezüglich des Punktes Behinderung festgelegt. Hier kann der Rücktritt nur während der bestehenden Leistungsstörung geltend gemacht werden. Dies bedeutet, dass der/die AuftraggeberIn gemäß ÖNORM die zeitliche Dimension (keine Nachfristsetzung bzw. Rücktrittserklärung 30 Tage ab Kenntnis) beachten muss, um vom Vertrag zurücktreten zu können. Der/Die AuftraggeberIn ist deshalb auf diese Abweichung nachweislich aufmerksam zu machen. Darüber hinaus ist der/die AuftraggeberIn darauf hinzuweisen, dass der Rücktritt vom Vertrag nur „schriftlich“ erklärt werden kann.
Leistungsfortsetzung (Punkt 5.9.1) Formulierungsvorschlag: Schlichtungsverfahren/Schiedsgericht (Punkte 5.9.2 und 5.9.3) Formulierungsvorschlag:
Sollte ein Probebetrieb gewünscht sein, so wäre dieser im Vertrag zu vereinbaren. Durch die Anwendung der ÖNORM B 2110 alleine wird nicht automatisch ein Pobebetrieb durchgeführt.
Die ÖNORM B 2110 sieht dazu folgende Regelung vor: Punkt 6.5.3: Aber ACHTUNG: Formulierungsvorschlag:
Gemäß § 1151 ABGB handelt es sich um einen Werkvertrag, wenn jemand die Herstellung eines Werkes gegen Entgelt übernimmt. Hiebei unterscheidet man unterschiedliche Arten des Entgelts – Geld oder Naturalleistungen, Pauschalpreis, Einheitspreis, Regiepreis bzw. Festpreis und veränderliche Preise. Wird ein Einheitspreis zwischen den Vertragspartner vereinbart, bleibt dieser bis zum Vertragsende erhalten. Die ÖNORM B 2110 sieht hiezu folgende Regelung vor: Wenn es zu einer bloßen Mengenänderung (ohne Leistungsabweichung) kommt, hat nach dieser Regelung der Vertragspartner einen Preisänderungsanspruch. Innerhalb der 20 %-Klausel bleiben die Einheitspreise jedoch gleich. Alternativer Formulierungsvorschlag:
Die ÖNORM B 2110 sieht dazu folgende Regelung vor:
Die Regelung der ÖNORM könnte dahingehend entschärft werden, dass die 5 %-Grenze angehoben wird. Formulierungsvorschlag:
Gemäß §§ 1165 ff ABGB schuldet der/die AuftragnehmerIn die mangelfreie Herstellung des Werkes. Erst nach Vertragserfüllung kann er/sie Zahlung vom Auftraggeber/von der Auftraggeberin verlangen. Ist das Werk mangelhaft, besteht also grundsätzlich keine Zahlungsverpflichtung. Der/Die AuftraggeberIn kann das Entgelt zurückbehalten. Die ÖNORM B 2110 sieht dazu folgende Regelung vor: Punkt 10.4: Dieser Punkt sieht demnach eine Beschränkung des Zurückbehaltungsrechtes vor. Der/Die AuftraggeberIn kann das Entgelt nur mehr bis zur dreifachen Höhe der voraussichtlichen Kosten der Ersatzvornahme einbehalten. Sollte der/die AuftraggeberIn die gesetzliche Regelung bevorzugen, wäre dies im Vertrag zu vereinbaren. Auf jeden Fall ist er/sie nachweislich darauf hinzuweisen. Formulierungsvorschlag:
Die Önorm B 2110 sieht dazu folgende Regelung vor: Abweichend zur gesetzlichen Regelung wird hier dem/der Auftraggeber/in eine Rügepflicht bei offensichtlichen Mängeln auferlegt. Die fehlende Rüge kann einen schlüssigen Verzicht auf Gewährleistungsansprüche bedeuten. Der/Die Auftraggeber/in ist darauf nachweislich hinzuweisen bzw. wäre diese Rügepflicht zu streichen. Entsprechendes gilt für Punkt 12.2.3.1. Formulierungsvorschlag:
Grundsätzlich folgen die Haftungsbestimmungen den gesetzlichen Regelungen, die ÖNORM B 2110 sieht jedoch zwei Ausnahmen vor: Die ÖNORM B 2110 sieht dazu folgende Regelung vor: Punkt 12: Gemäß § 1168a ABGB könnte der/die UnternehmerIn kein Entgelt verlangen, wenn das Werk vor seiner Übernahme durch einen bloßen Zufall zu Grunde geht. Formulierungsvorschlag:
Die ÖNORM B 2110 sieht dazu folgende Regelung vor: Punkt 12.3: Nach der gesetzlichen Regelung gebührt bei leichtem Verschulden (leichte Fahrlässigkeit) grundsätzlich der positive Schaden (wirklicher Schaden) und grobem Verschulden (Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit) die volle Genugtuung (positiver Schaden und entgangener Gewinn). Die Regelung in der ÖNORM bedeutet demgemäß eine erhebliche Einschränkung für den/die AuftraggeberIn, worauf entsprechend nachweislich hinzuweisen ist. Sollte die gesetzliche Regelung seitens des Auftraggebers/der Auftraggeberin gewünscht werden, ist eine vertragliche Vereinbarung notwendig. Formulierungsvorschlag:
Gemäß § 1295 Abs. 1 ABGB haftet jede/r AuftragnehmerIn dem/der AuftraggeberIn für schuldhaft zugefügte Schäden. Die Haftung erstreckt sich auch auf von seinen/ihren SubunternehmerInnen verursachte Schäden (§ 1313a ABGB). Im Zweifel gilt gemäß § 1296 ABGB jedoch die Vermutung, dass ein Schaden ohne Verschulden eines anderen entstanden sei. Die ÖNORM B 2110 sieht dazu folgende Regelung vor: Punkt 12.4: Damit die Regelung der ÖNORM und vor allem die prozentuelle Obergrenze (0,5 % der jeweiligen ursprünglichen Auftragssumme) nicht zur Anwendung gelangt, muss die Geltung der gesetzlichen Bestimmungen im Vertrag vereinbart werden. Formulierungsvorschlag: Zu diesem Zweck können Sie das angefügte Musterformular Warnpflicht verwenden. (Stand: 07.2021, basierend auf ÖNORM B2110, Ausgabe: 2013-03-15)
|
Startseite > Recht > Alles was Recht ist > Alles was Recht ist
Shortlinks
| Umsatzmeldeformular | |
| Mitgliederverzeichnis | |
| Bundeskammer | |
| Inserate und Kooperationen | |
| Webshop | |
| Login Normenabo | |
| AUFBAUEND - ORF Serie |
Community
Videos
Partner