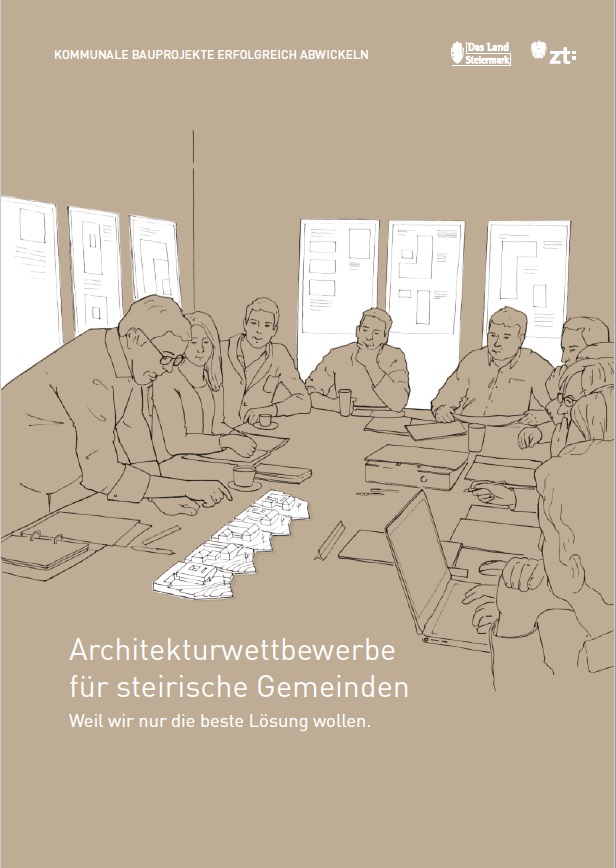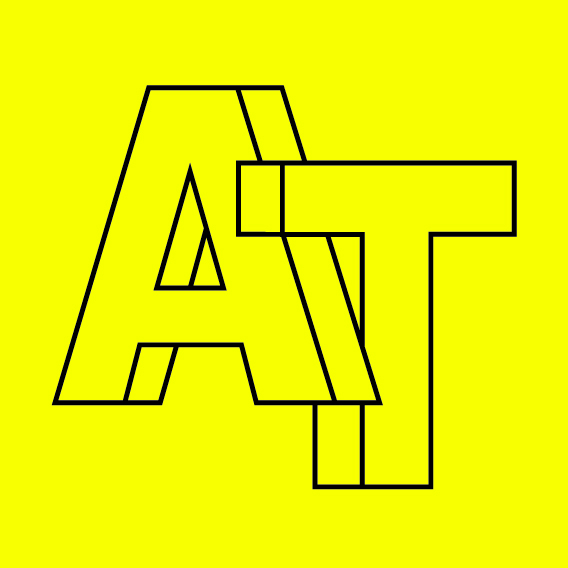Sicherstellung des Werklohnes - Leistungsverweigerungsrecht
Obwohl der Sicherstellungsanspruch des § 1170b ABGB bereits durch das Handelsrechtsänderungsgesetz (BGBl I Nr 120/2005, www.ris.bka.gv.at) am 01.01.2007 in Kraft trat, ist seine praktische Bedeutung in der Bauwirtschaft nach wie vor gering. Dies verwundert, da die Sicherstellungspflicht nicht nur das Insolvenzrisiko mindert, sondern für eine Baufirma oder einen Planer auch ein Rechtsinstrument darstellen kann, um aus unliebsamen Auftragsverhältnissen herauszukommen.
Sicherstellung bei Bauverträgen
§ 1170b ABGB sieht das unabdingbare Recht des Werkunternehmers eines Bauwerks, einer Außenanlage zu einem Bauwerk oder eines Teils hievon, vor, vom Auftraggeber ab Vertragsabschluss für das noch ausstehende Entgelt eine Sicherstellung zu verlangen. Der Anspruch auf Sicherstellung besteht unabhängig davon, ob durch eine allfällige Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers die Bezahlung des Entgeltes gefährdet ist.
Durch § 1170b ABGB sind auch Planungsleistungen mitumfasst. So haben etwa auch Architekten, die ihren Auftrag zur Herstellung von Plänen regelmäßig auf Werkvertragsbasis erbringen, einen gesetzlichen Anspruch auf Sicherstellung. Ein Recht auf Sicherstellung besteht nur dann nicht, wenn der Auftraggeber eine juristische Person des öffentlichen Rechtes oder ein Verbraucher ist.
Art und Höhe der Sicherstellung
Die Höhe der Sicherstellung beträgt 20 % des vereinbarten Werklohnes. Bei Verträgen, die innerhalb von drei Monaten zu erfüllen sind, beträgt die Sicherstellung 40 % des vereinbarten Werklohnes. Maßgebend für die Höhe der Sicherheit ist stets das Gesamtentgelt und nicht der bereits fällige oder der noch nicht beglichene Teil des Werklohnes. Das Recht auf Sicherstellung endet erst dann, wenn das vereinbarte Entgelt vollständig bezahlt ist. Als Sicherstellung können Bargeld, Bareinlagen, Sparbücher, Bankgarantien oder Versicherungen dienen. Die Entscheidung, welche Sicherheit geleistet wird, obliegt dem Sicherungsgeber. Die Kosten der Sicherstellung hat der Werkunternehmer zu tragen, soweit sie pro Jahr 2 % der Sicherungssumme nicht übersteigen. Die begehrte Sicherstellung ist binnen angemessener, vom Unternehmer festzusetzender Frist zu übergeben.
Leistungsverweigerungsrecht
Kommt der Auftraggeber dem Verlangen des Unternehmers auf Leistung einer Sicherstellung nicht, nicht ausreichend oder nicht rechtzeitig nach, so kann der Unternehmer seine Leistung verweigern und unter Setzung einer angemessenen Nachfrist die Vertragsaufhebung erklären (§ 1170b Abs 2 iVm § 1168 Abs 2 ABGB). Je nachdem, in welcher Bauphase die Sicherstellung verlangt wurde, kann der Werkunternehmer den Beginn der Bauarbeiten, die Fortführung oder, wenn die Sicherstellung erst nach erfolgter Übergabe verlangt wurde, auch die Mängelbehebung verweigern. Nach Aufhebung des Vertrages muss der Werkunternehmer das Werk nicht mehr fertig stellen und kann dessen ungeachtet nach § 1168 Abs 1 ABGB Werklohn in Höhe des noch offenen Entgelts abzüglich der durch das Unterbleiben der Herstellung ersparten Kosten geltend machen.
Vorleistungspflicht des Werkunternehmers
Außerhalb des § 1170b ABGB ist das Leistungsverweigerungsrecht sehr eingeschränkt: In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass Unternehmer die Weiterarbeit und Fertigstellung eines Bauwerks gegenüber ihrem Auftraggeber von der sofortigen Zahlung eines fälligen Rechnungsbetrages abhängig machen und für den Fall der Nichtzahlung die Leistungseinstellung ankündigen. Tatsächlich hat der Werkunternehmer diese Möglichkeit außerhalb des § 1170b ABGB nicht: Gemäß § 1170 ABGB ist nämlich das Entgelt beim Werkvertrag – sofern nicht anders vereinbart - erst nach vollendetem Werk zu entrichten und der Werkunternehmer daher vorleistungspflichtig. Er hat zunächst seine Leistung vollständig zu erbringen und kann erst dann seinen Werklohn fordern. Nur dann, wenn der Werkunternehmer eine Mehrheit von einander unabhängigen Werken herzustellen hat (OGH 24.9.2008, 7 Ob 183/08z, www.ris.bka.gv.at) und diesen Werken nach der maßgeblichen Verkehrsauffassung der Charakter selbstständiger Leistungen zukommt, kann der Auftragnehmer einen verhältnismäßigen Teil des Entgelts schon vorher fordern (§ 1170 Satz 2 ABGB).
Darüber hinaus hat der Werkunternehmer auch die Möglichkeit, Unsicherheitseinrede nach § 1052 ABGB zu erheben. Dieses Recht besteht jedoch nur dann, wenn eine Entgeltforderung des Werkunternehmers durch schlechte Vermögensverhältnisse des Auftraggebers gefährdet ist. Die Frage der Vermögensverschlechterung ist dabei objektiv anhand der gesamten Sachlage zu beurteilen.
Ergebnis
Zusammenfassend kann sohin festgehalten werden, dass die Sicherheitseinrede nach § 1170b ABGB der Baufirma oder dem Planer ein Rechtsinstrument einräumt, das richtig eingesetzt, geeignet ist, die Rechtsposition des ansonsten vorleistungspflichtigen Werkunternehmers erheblich zu verbessern.
Dr. Volker Mogel
Kaan Cronenberg & Partner Rechtsanwälte GmbH & Co KG
Kalchberggasse 1
A-8010 Graz
Tel:+43/316/83 05 50
Fax: +43/316/81 37 17
E-Mail: volker.mogel@kcp.at
|